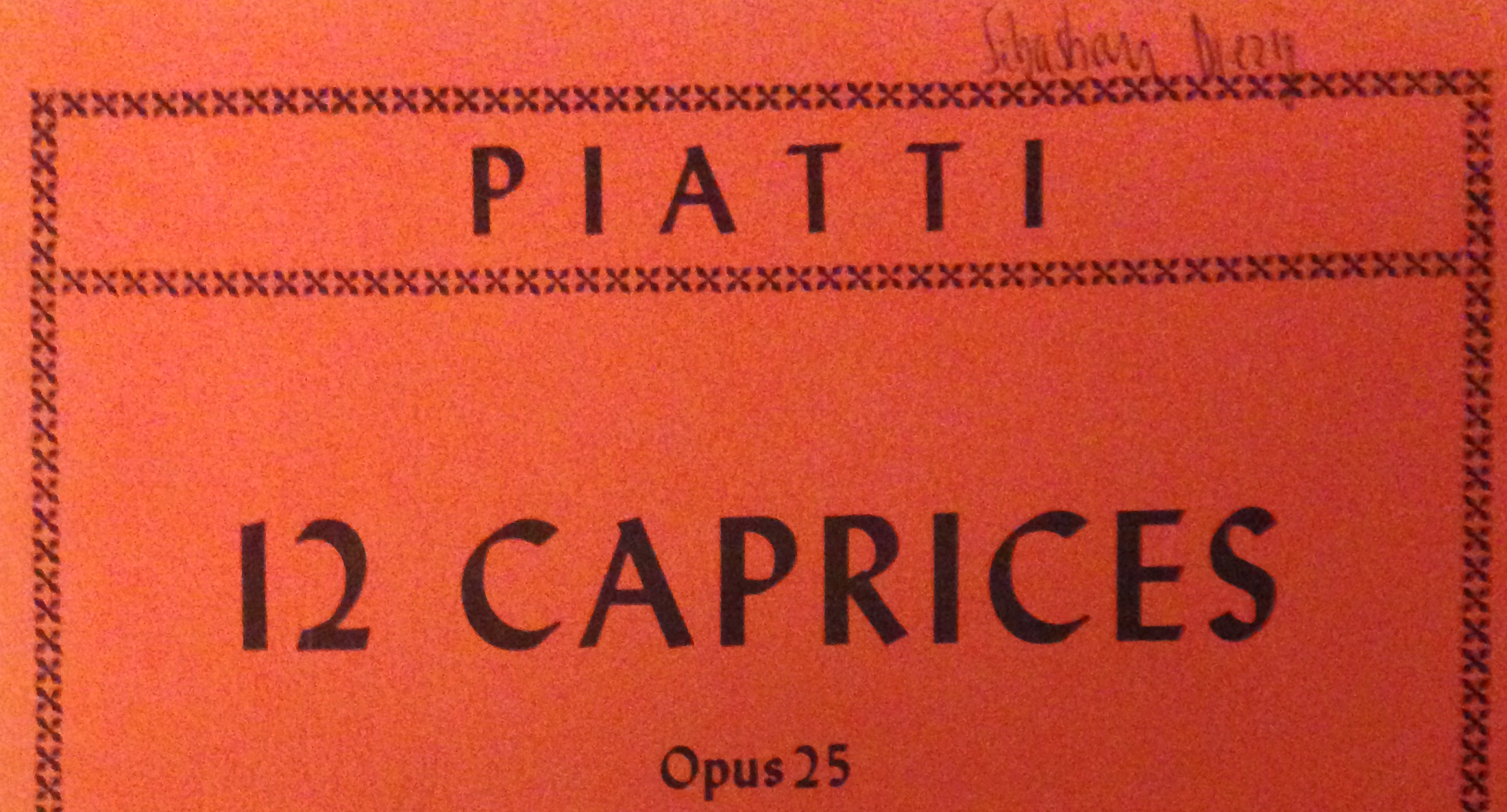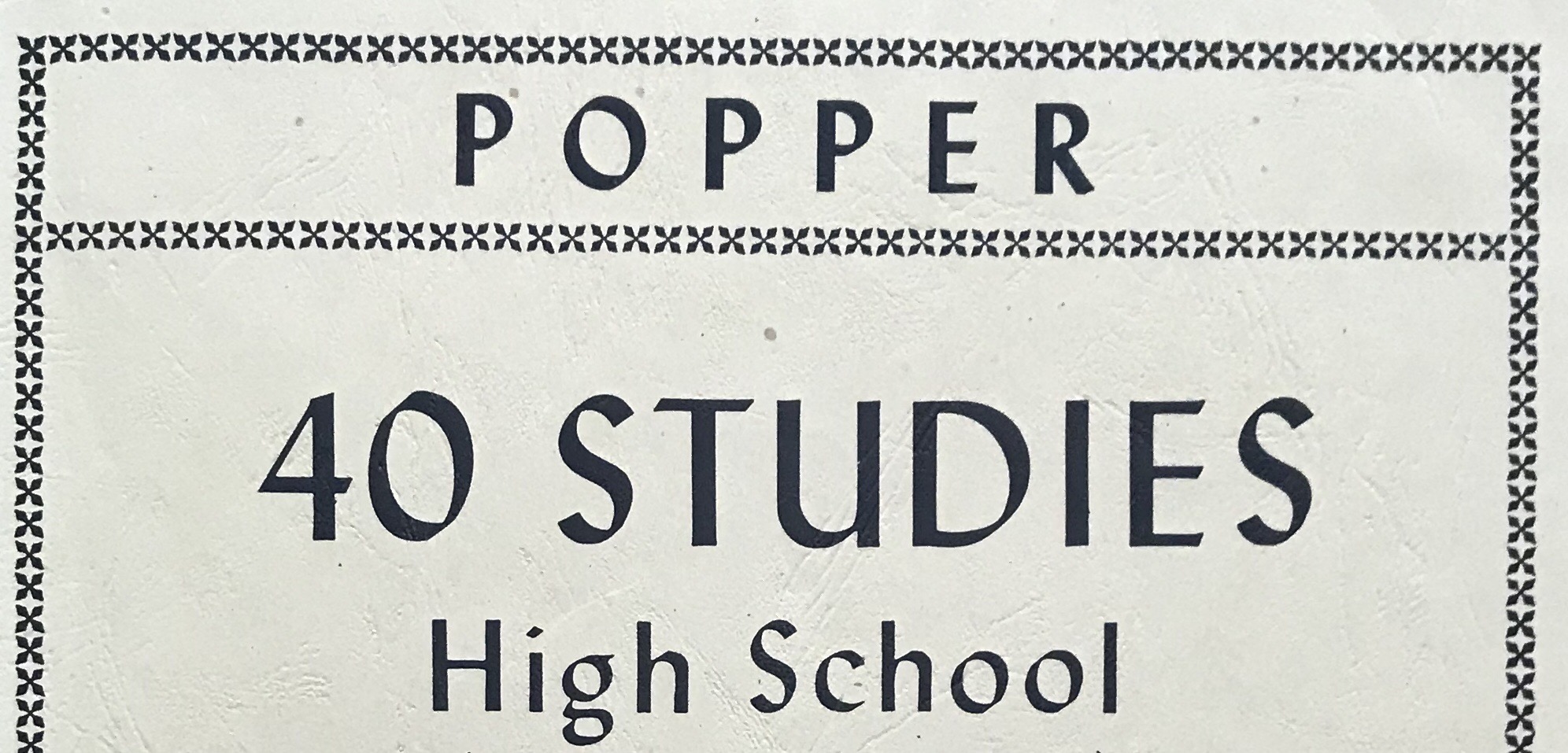
Langsam aber sicher bahne ich mir einen Weg durch David Poppers High School Book und ich freue mich, heute ein neues Video präsentieren zu können.
Nr. 17 ist kurz und prägnant. Die Form des Stücks ist A-B-A, und während ich den A-Teil in einer von der Romantik inspirierten und dafür typisch aufgewühlten Stimmung empfinde, ist der B-Teil viel zarter (Adagio und Piano dolce). In technischer Hinsicht erkundet Popper in dieser Etüde sich schnell bewegenden Doppelgriffsequenzen (zumeist Sexten und im Mittelteil auch andere Intervalle, darunter sogar einige ungewöhnliche wie Dezimen).
In den A-Teilen stechen die Basstöne automatisch heraus, was wahrscheinlich der Grund dafür ist, dass Popper auf die hohen Noten (auf dem zweiten und vierten Schlag) Akzente gesetzt hat. Um diese akzentuierten Noten noch mehr hervorzuheben, spiele ich sie kürzer und trenne sie dadurch von der nächsten Note, damit sie sich deutlicher von der folgenden Musik abheben. Ich spiele die A-Teile auch in einem eher bewegten Tempo, weil dies musikalisch für mich mehr Sinn macht. Allerdings werden die Doppelgriff-Abläufe dadurch schwieriger.