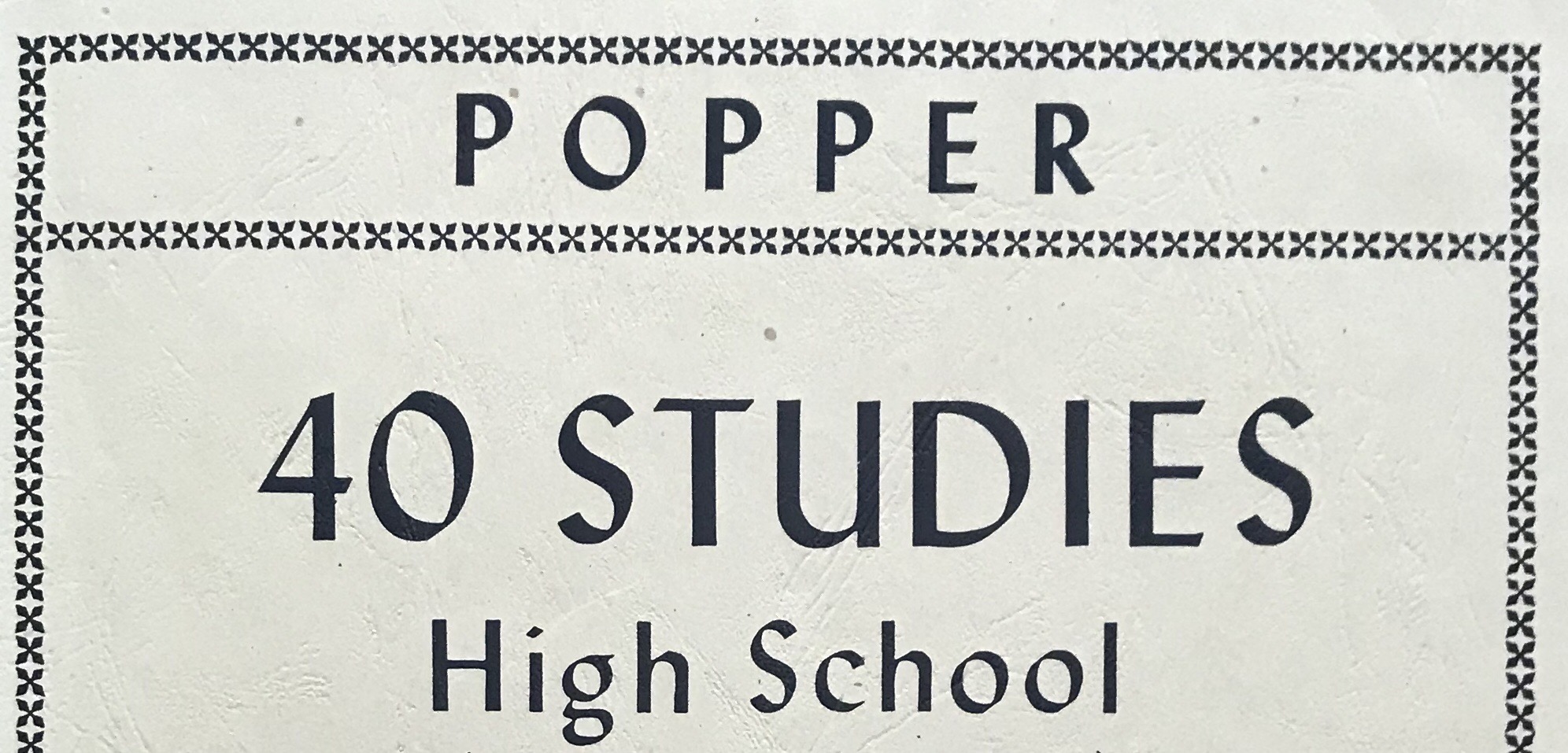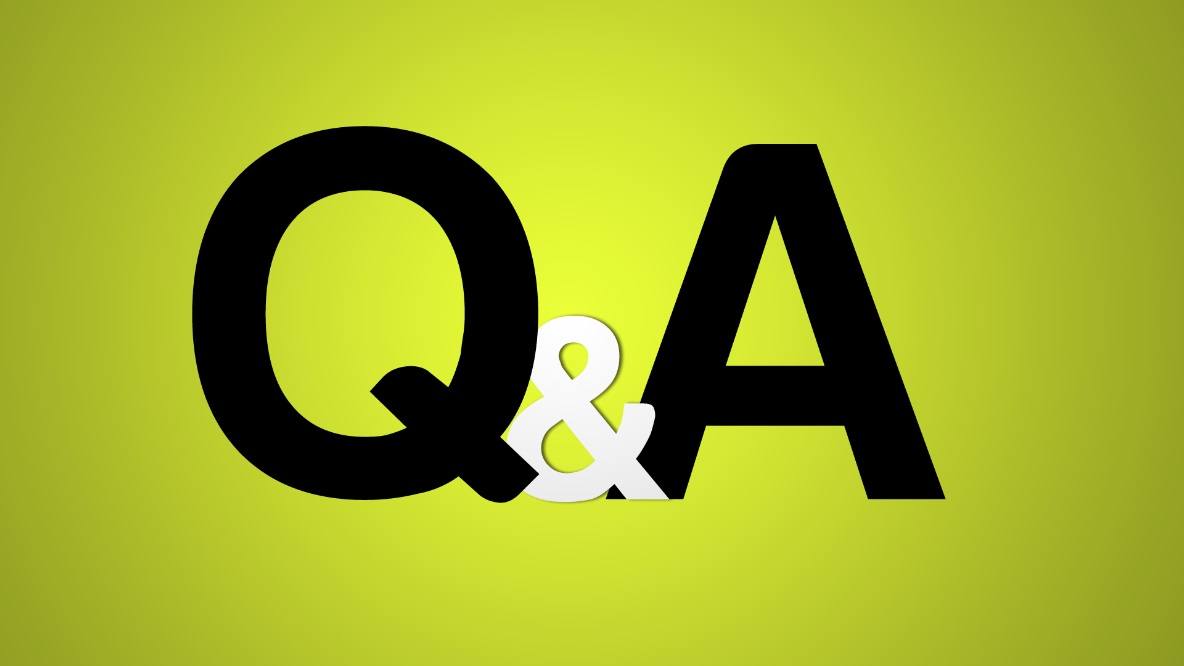
Ab und zu stellen mir Leser eine Frage von allgemeinem Interesse. Ich publiziere sie dann mit meiner Antwort anonymisiert unter der Rubrik Q & A (Question and Answer). Zögern Sie nicht: Auch Sie können mir Ihre Frage stellen.
Frage: Ich bin 52 und recht musikalisch ohne eine klassische Musikausbildung und mit einer manchmal üblen Intonation! Habe jetzt vor vier Wochen angefangen Cello zu lernen. (Mit Hilfe eines Lehrers und Youtube Tutorials). Zum einen, als Aufhänger in eine andere musikalische Welt einzutauchen aber auch als Motivation meine Musikalität auszubauen! Ich weiss, dass ich das Thema durchziehen werde. Ich arbeite halbtags und habe Zeit jeden Tag 60 Minuten zu üben (3×20). Ich habe mich entschieden gleich von Anfang an in ein neues Meisterinstrument zu investieren, da ich bei den anderen Instrumenten, die ich spiele, gelernt habe, dass es sich lohnt, in Material und Verarbeitung zu investieren. Habe mich für ein Cello von Walter Mahr Qualitätsstufe III entschieden. Kann ja nicht total falsch sein. Ich habe keine Kraft und keine Ahnung durch die Gegend zu fahren, um gebrauchte namenlose Celli zu testen. Was denkst Du? Evtl. gebe ich 20% zu viel aus, aber das klingt doch logisch. Oder?
Antwort: Es ist super, dass du Cello lernen möchtest! Deine Philosophie diesbezüglich und auch zum Cellokauf klingen vernünftig. Ein anderer Weg wäre übrigens dennoch denkbar: Ein Cello zu mieten. So kannst du in die Materie reinwachsen, ohne gleich viel Geld zu investieren.
Nun aber zum von dir angedachten Kauf. Ich kannte diesen Geigenbauer und seine Celli bislang nicht aber ich habe im Internet ein Angebot mit einem Cello der Qualitätsstufe III und den Preis (ca 5.751,26 €) gesehen und denke, dass du dir als Anfänger einen angemessenen Budgetrahmen gegeben hast (weder zu teuer noch zu billig). Auch ist es ein in Deutschland tätiger Geigenbauer, womit du günstige Ware aus Fernost ausschliesst. Da du deinen Lehrer erwähnst, würde ich das Cello nach Möglichkeit auch ihm zeigen, bevor du kaufst und ihn um seine Meinung fragen. Aber grundsätzlich hat er als Profi natürlich viel höhere Ansprüche und für dich ist am Anfang wohl fast jedes 4/4-Cello in gutem Zustand und in dieser Preisklasse gut. Somit denke ich, dass du nichts grundfalsch machst und wünsche viel Erfolg und Freude auf deinem Weg, das Cellospiel zu erlernen.